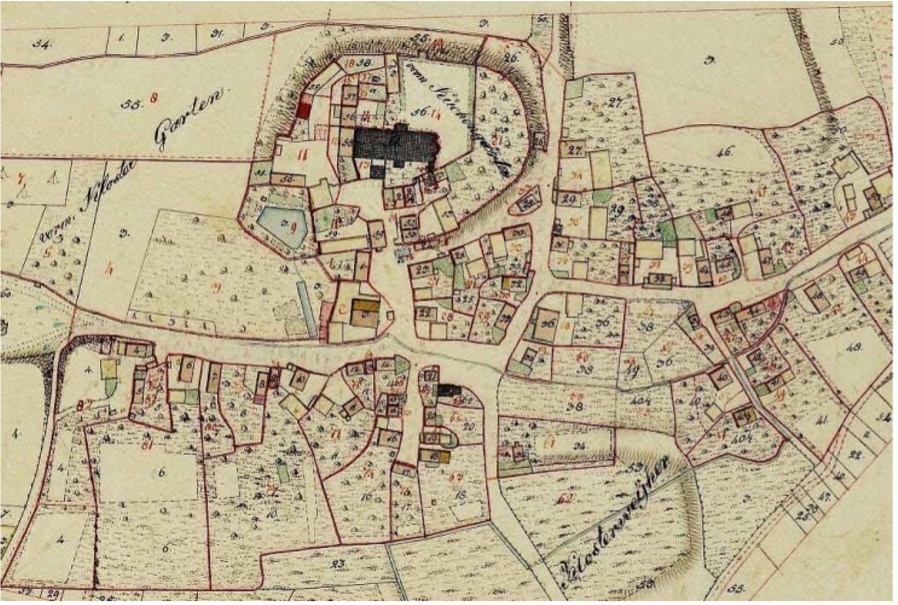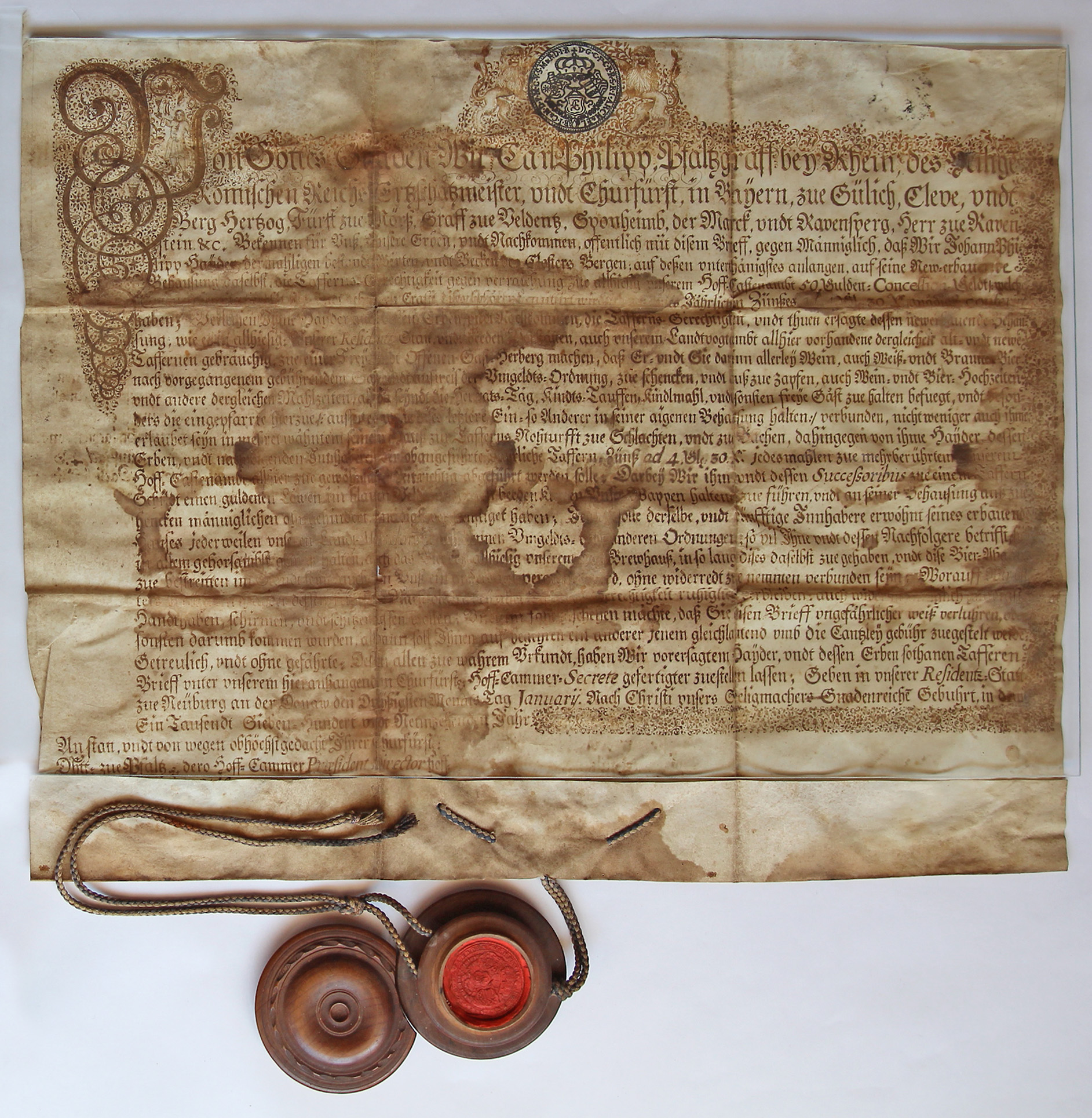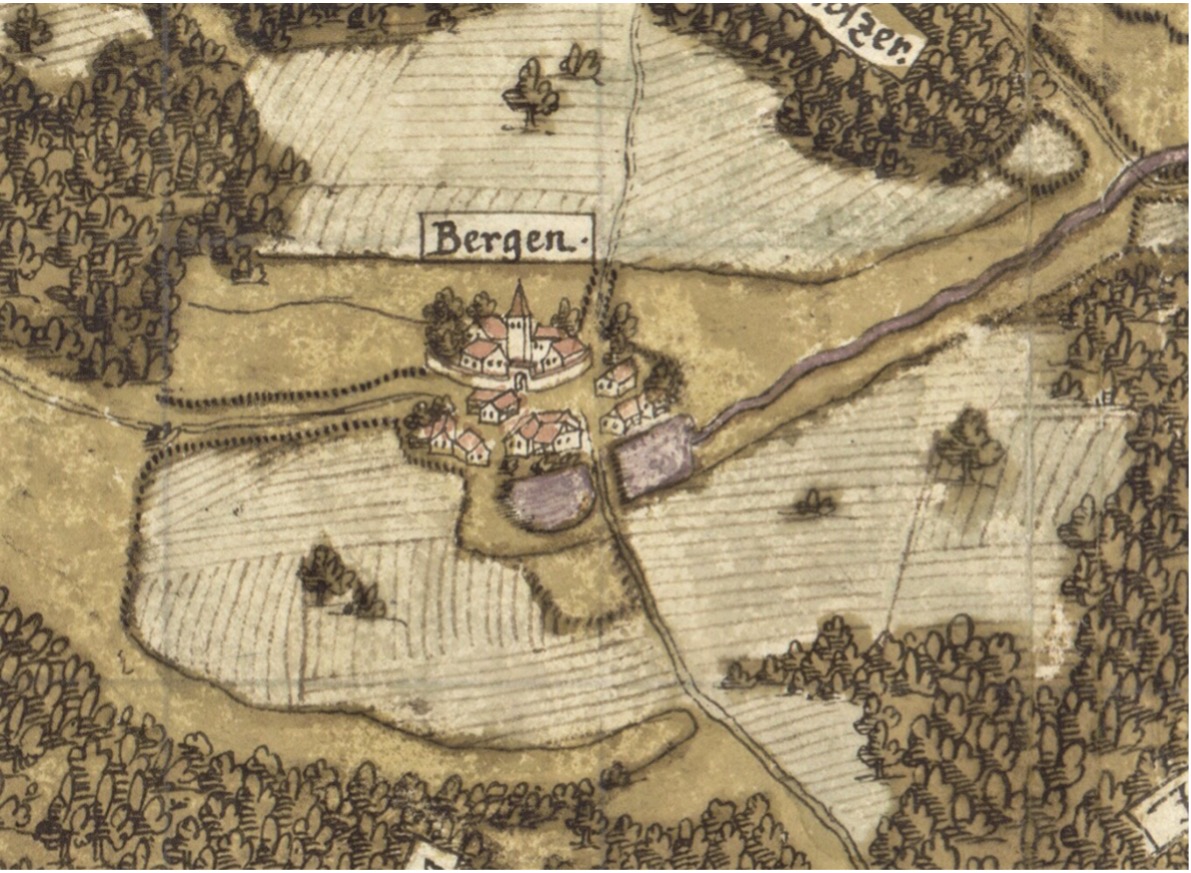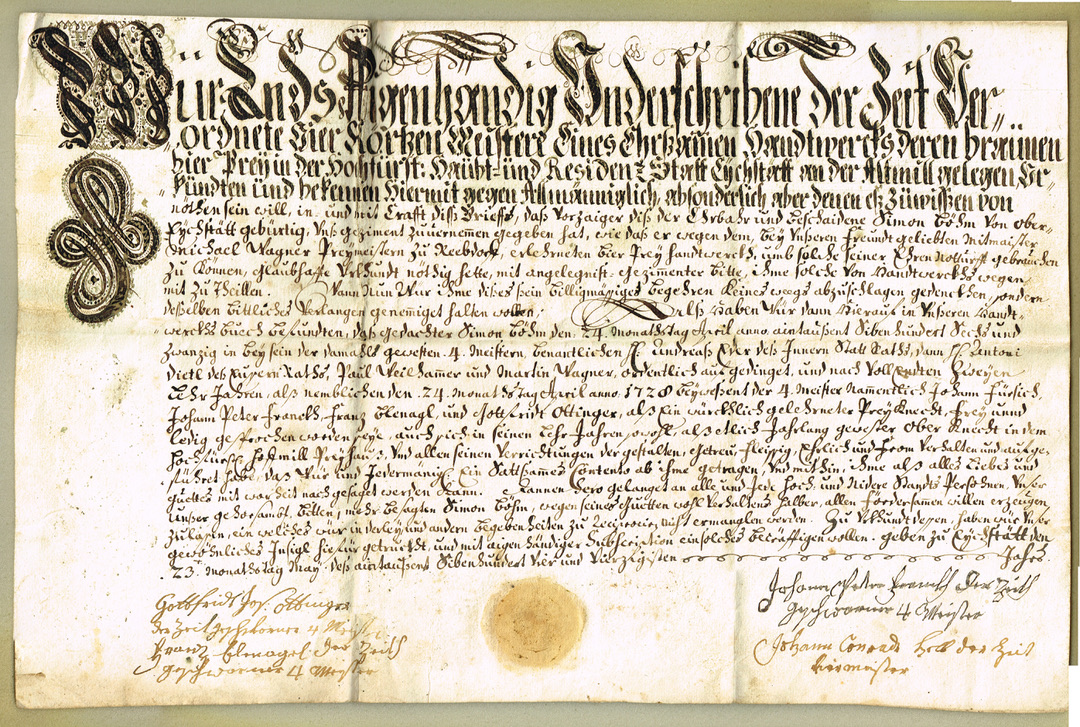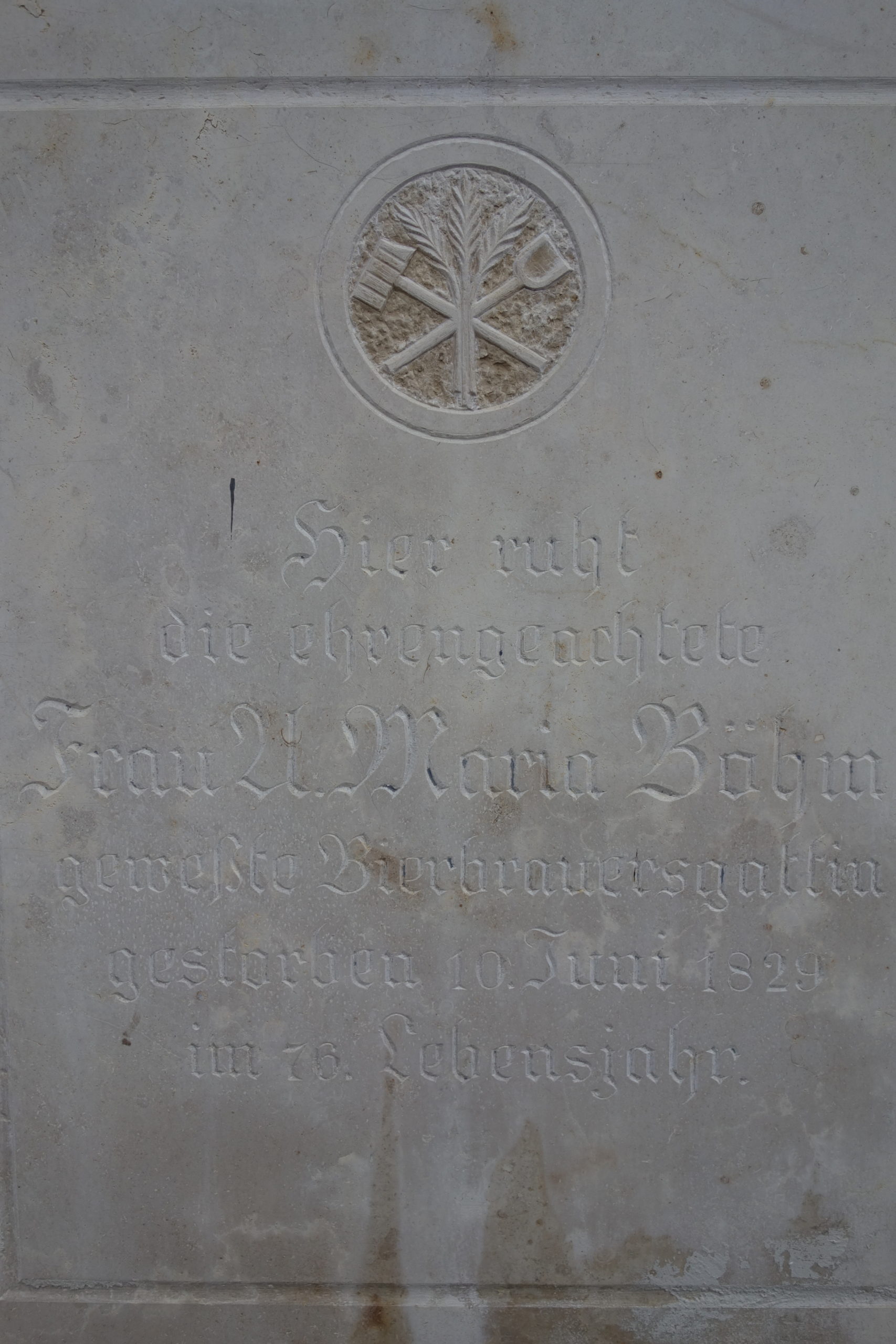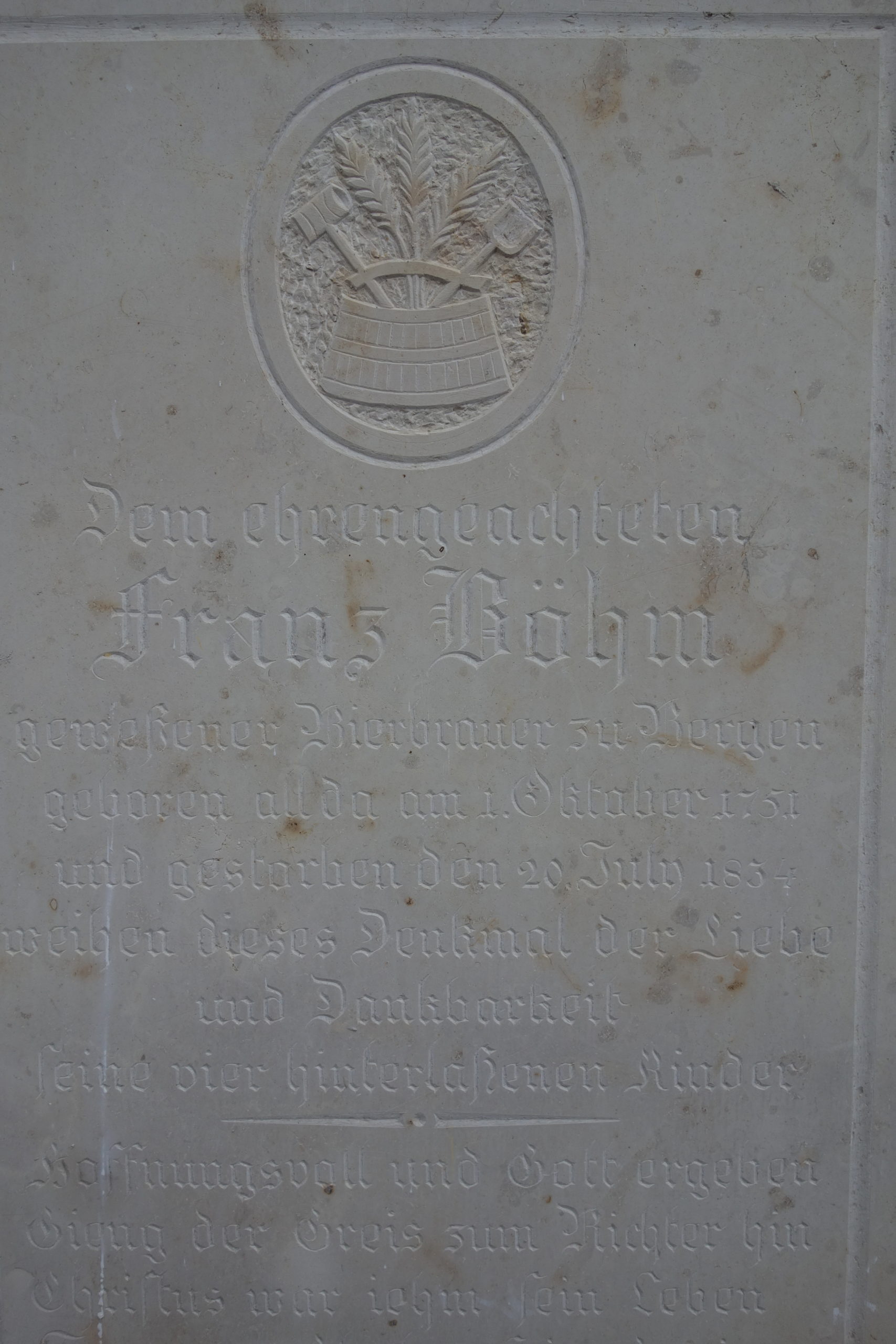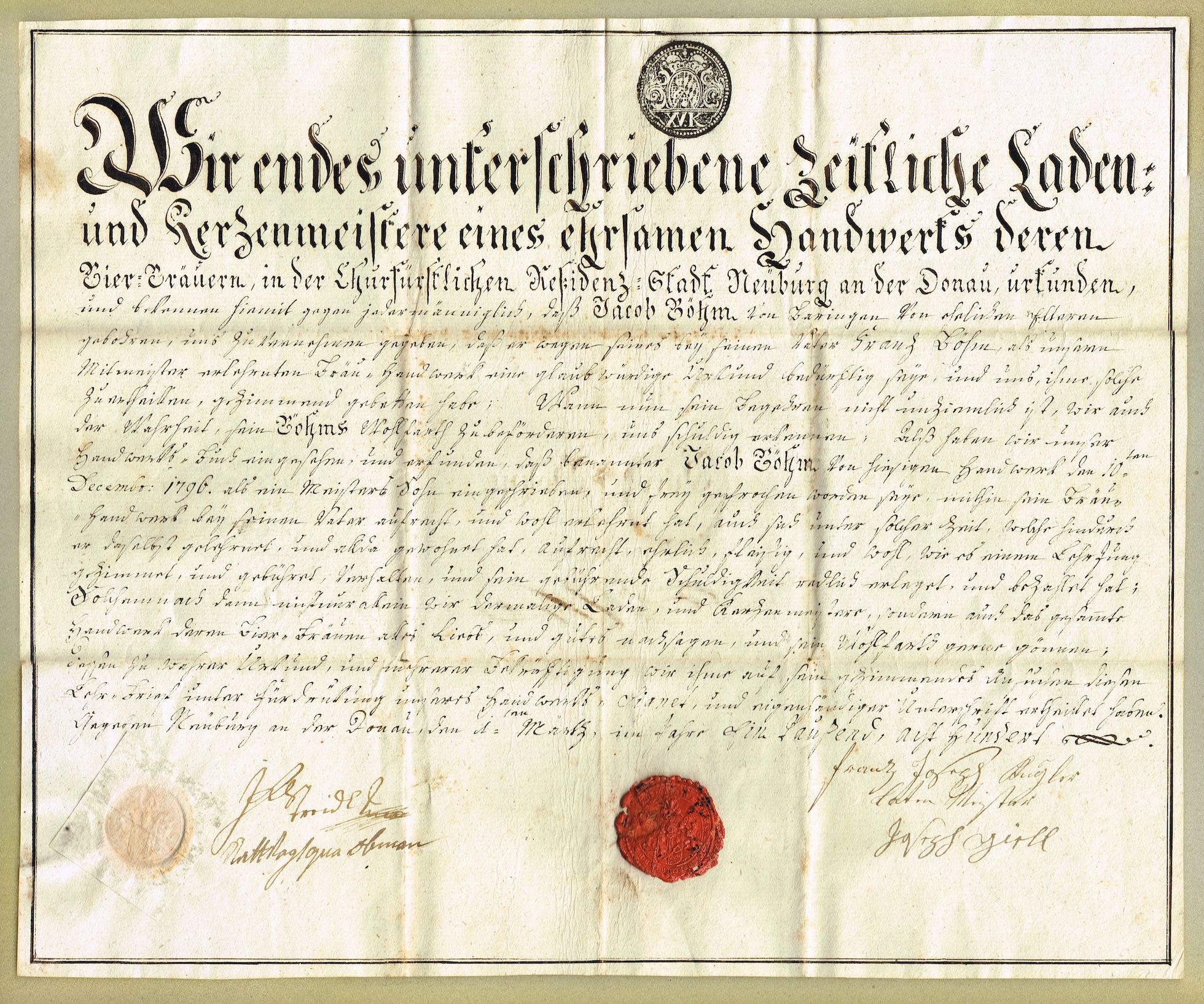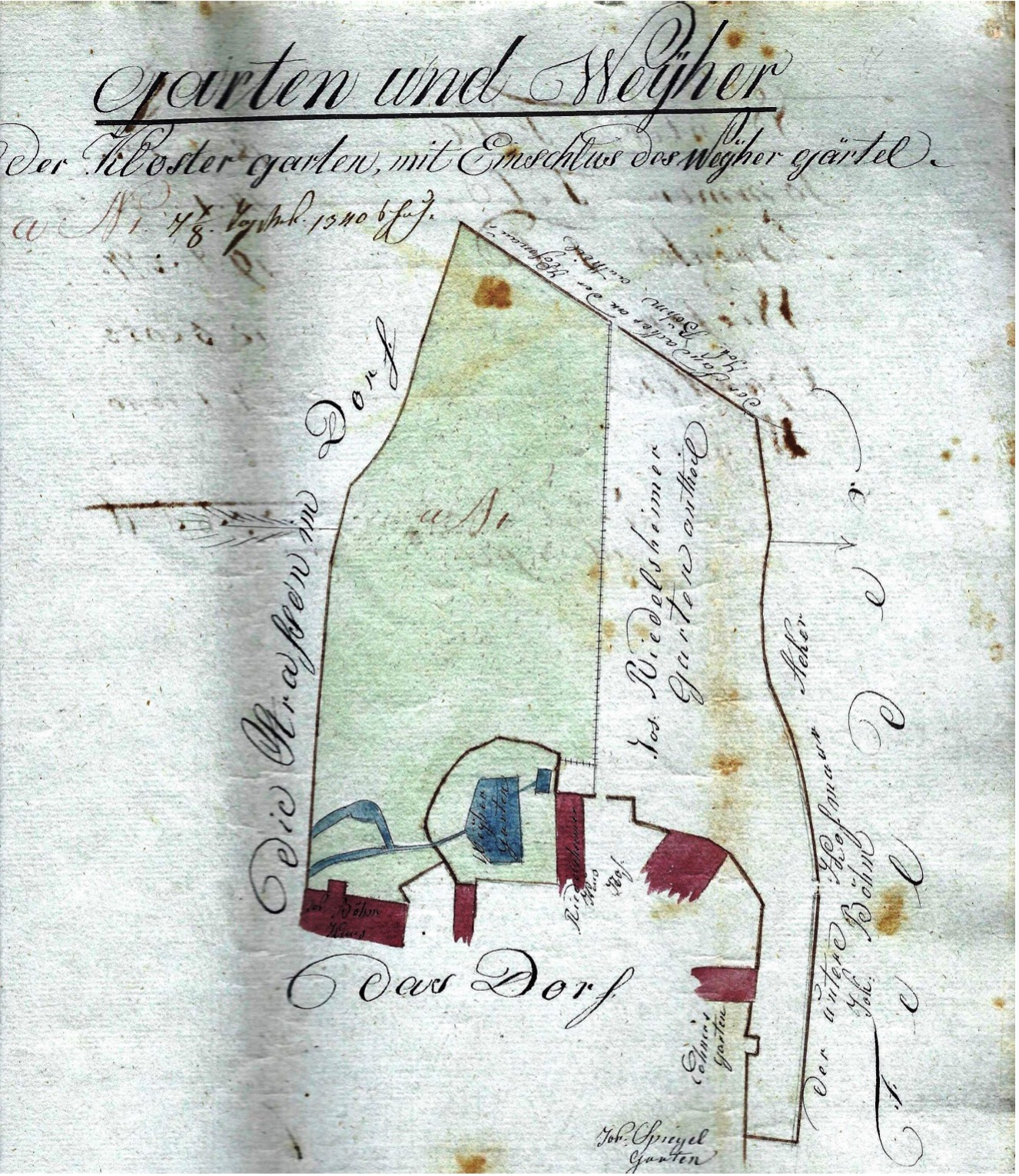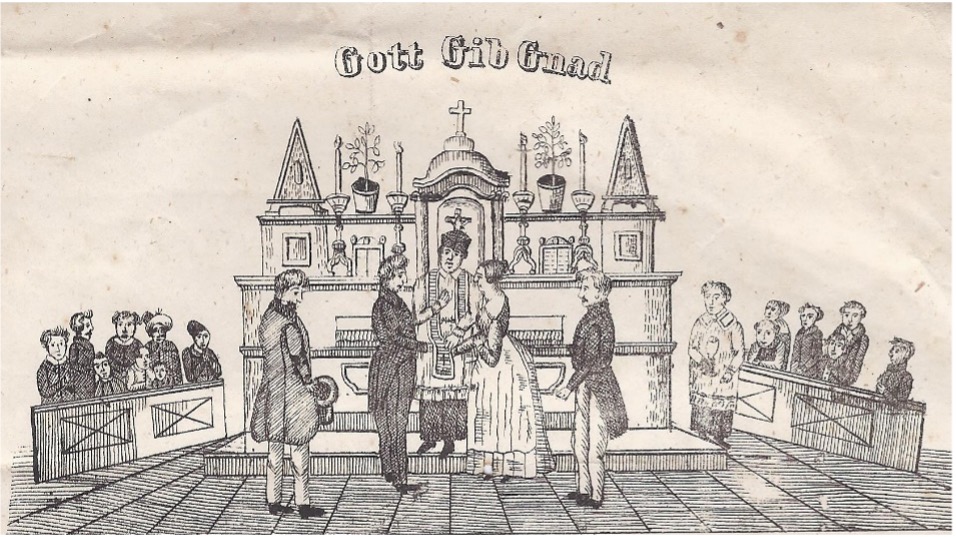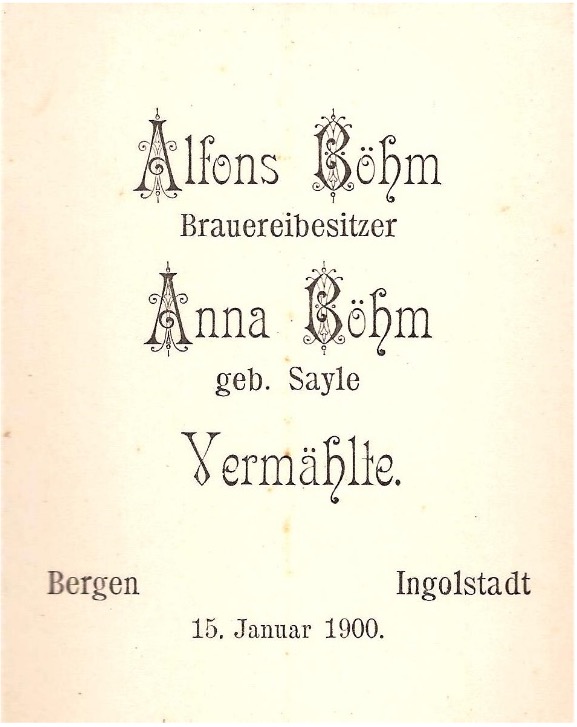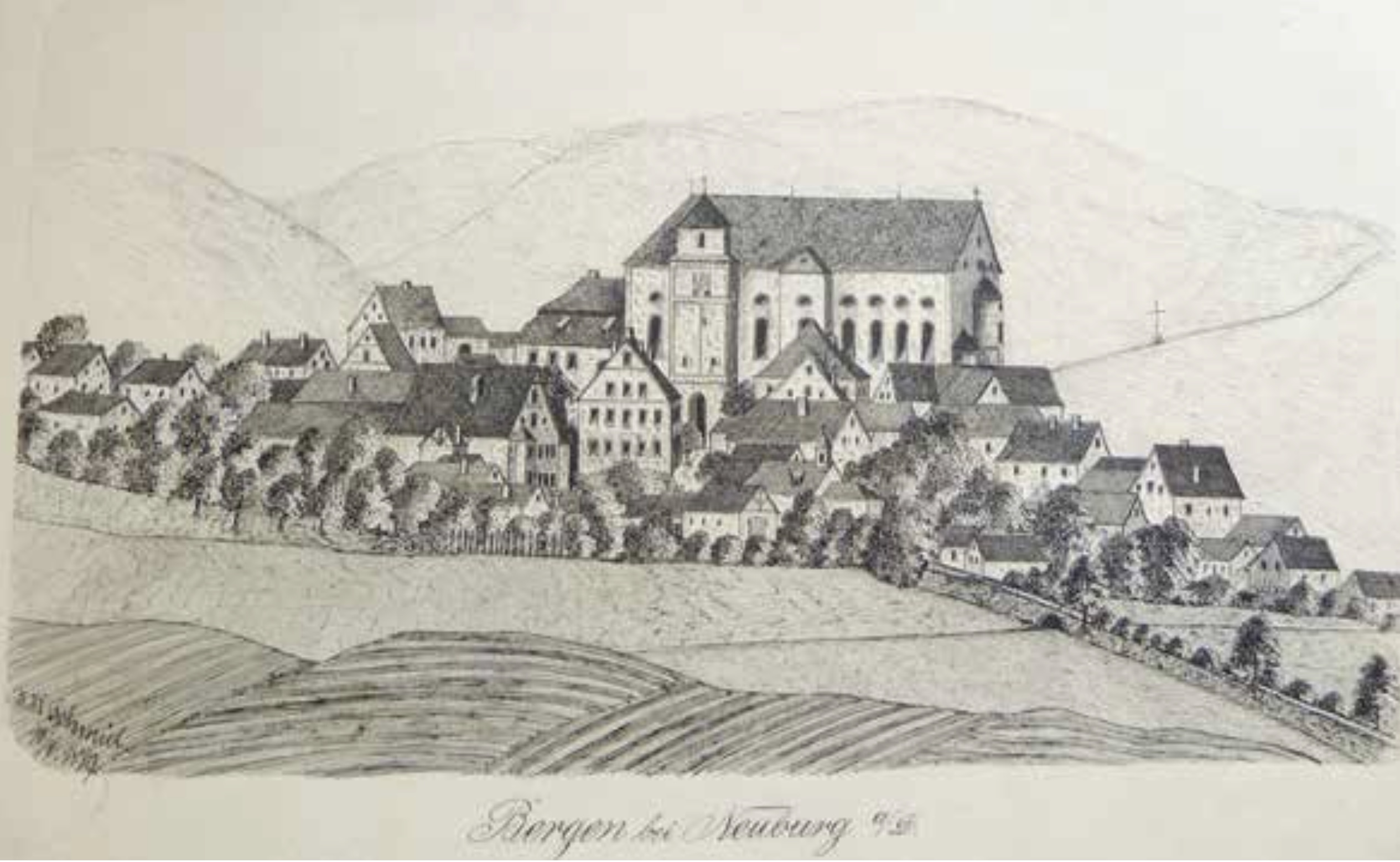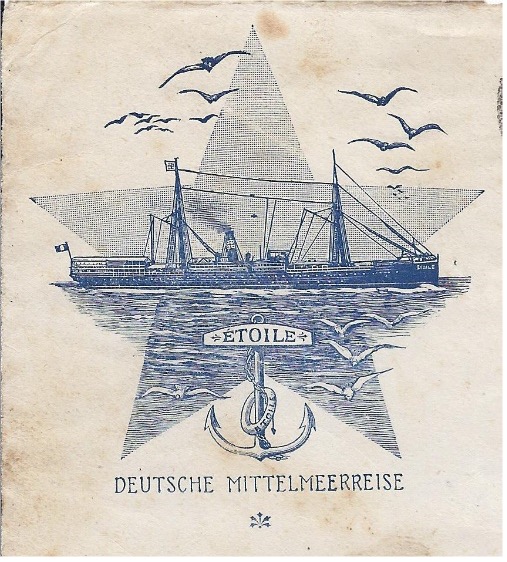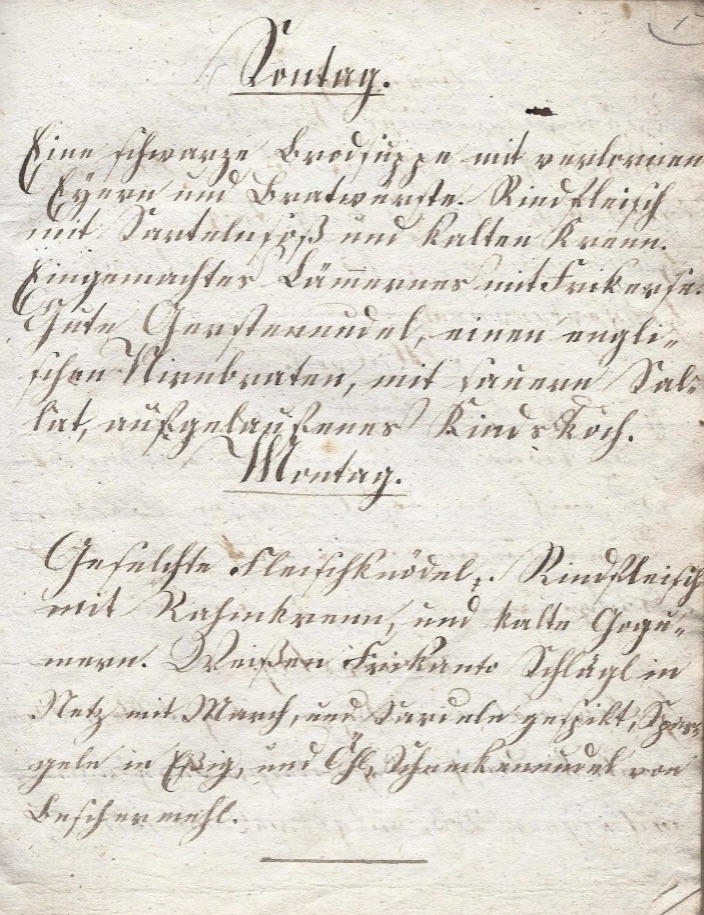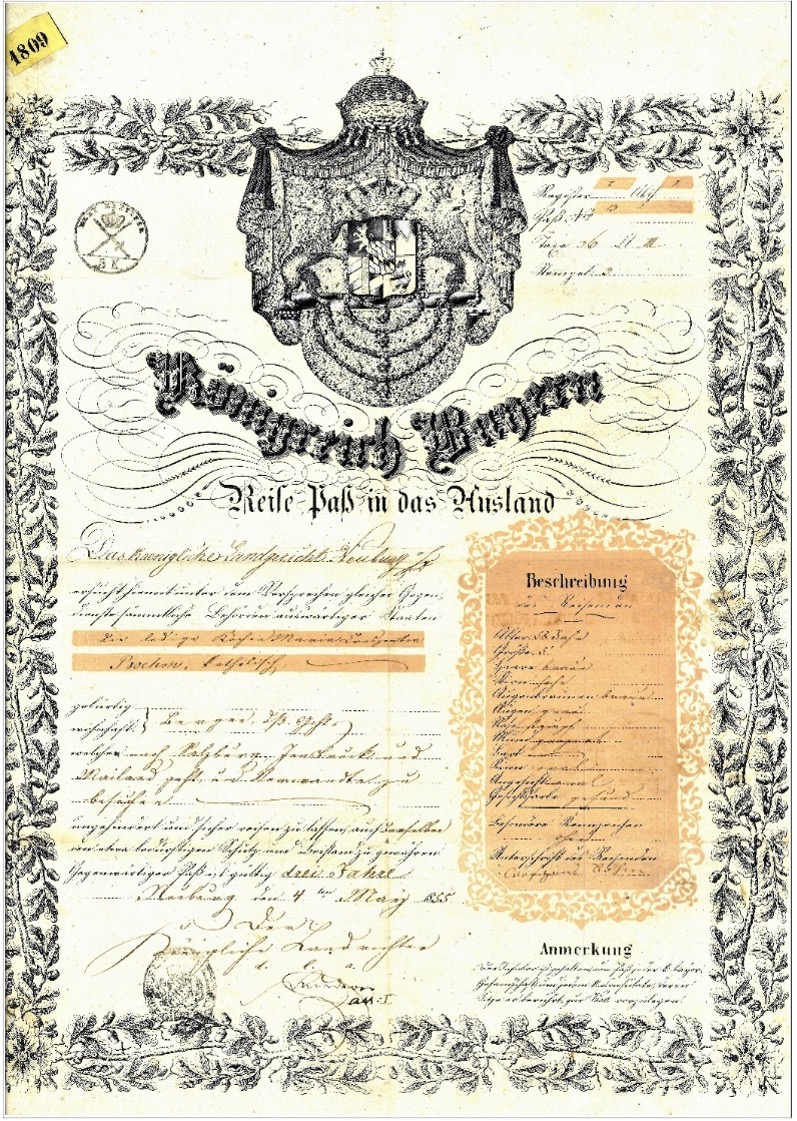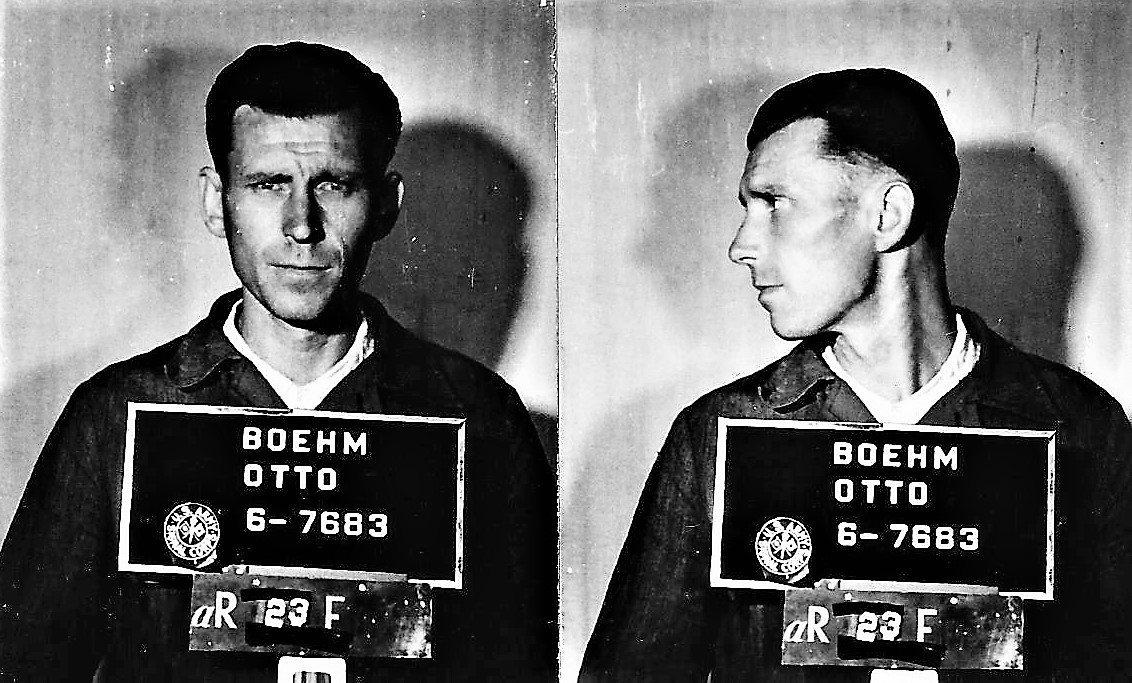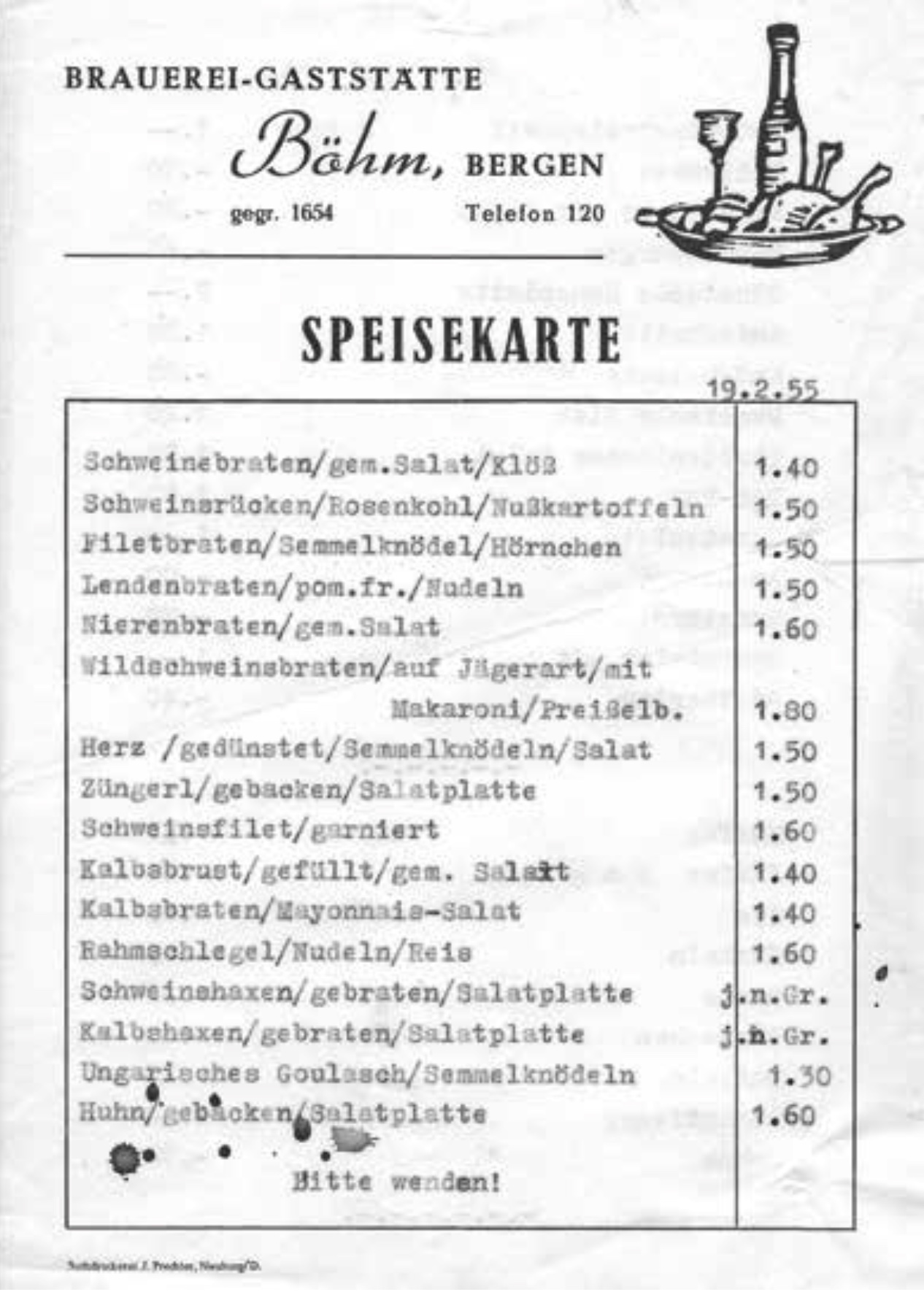Mittagsmenü
für die Woche
vom 4. bis 7. Februar 2025
Dienstag
Tagliatelle mit Jakobsmuschel
wilder Brokkoli | junge Karotten
Mittwoch
Backhendl vom Bachbauernhof
Kartoffelsalat | Sauce Remoulade
Donnerstag
Ragout vom Wildhasen mit Preiselbeeren
Rahmwirsing | geröstete Serviettenknödel
Freitag
Skrei – Winterkabeljau
Beurre blanc | Rote Rüben Risotto
Zu jedem Hauptgang erhalten Sie vorab eine Tagessuppe oder einen Blattsalat und als süßen Abschluss ein kleines Dessert aus unserer Patisserie!
3 Gänge: 34,50 €
(ohne Dessert 28 €)
Änderungen vorbehalten!